Umfassende Diagnostik in unserem Hormonzentrum
In unserem Hormonzentrum stehen Ihnen spezialisierte Ärztinnen und Ärzte für die Diagnose und Behandlung von Hormonerkrankungen zur Seite. Unser Schwerpunkt unterscheidet sich klar von dem der internistischen Endokrinologie und bietet eine auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Betreuung.
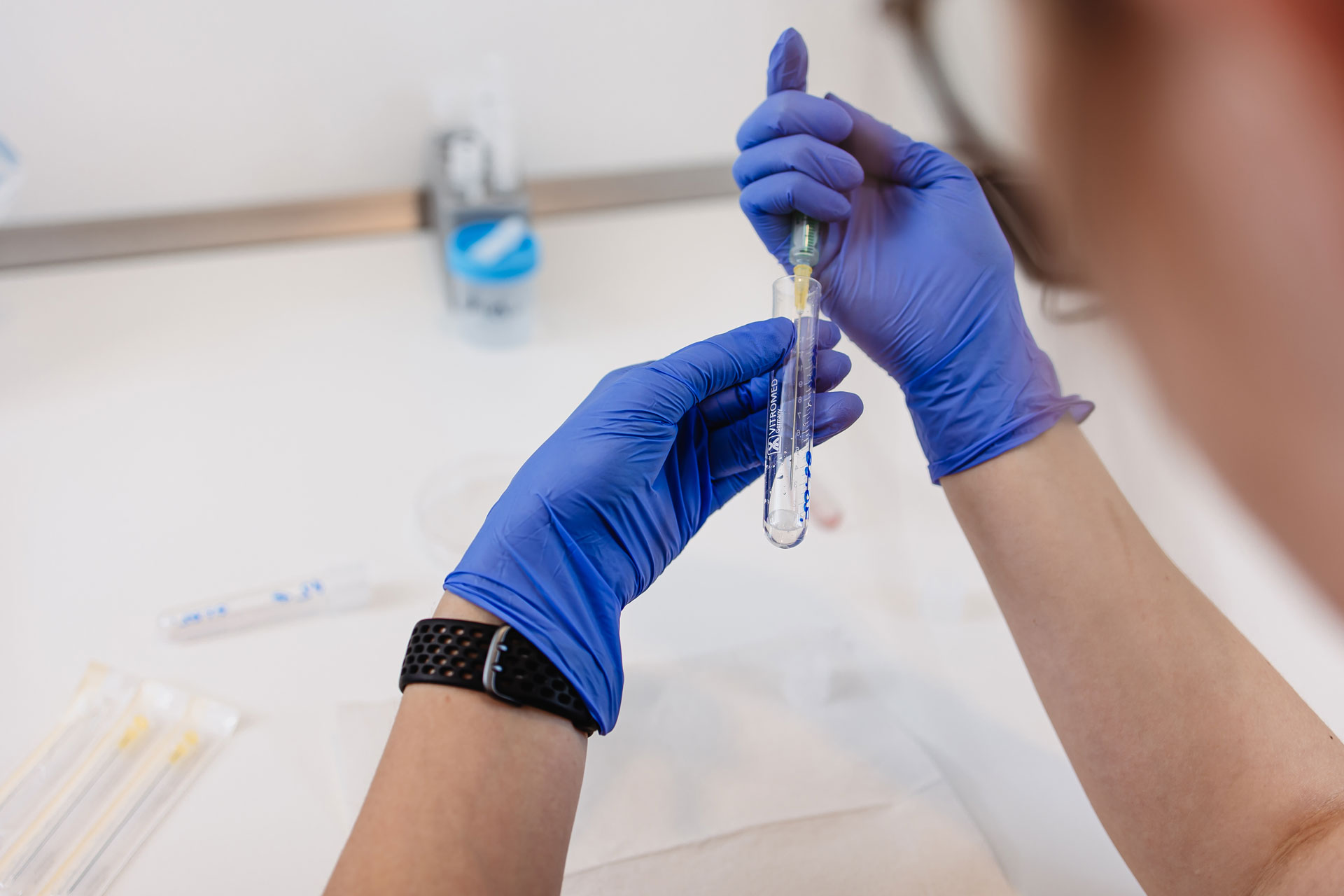
Hormonzentrum: Ihre Expert:innen für hormonelle Gesundheit
In unserem Hormonzentrum widmen wir uns der Untersuchung und Behandlung von Erkrankungen und Beschwerden, die durch Störungen der Hormonsysteme verursacht werden. Unsere spezialisierten Ärztinnen und Ärzte beraten Sie einfühlsam, führen gezielte Untersuchungen durch und entwickeln individuelle Behandlungskonzepte.
Hormone sind essenzielle Botenstoffe, die von speziellen Drüsen freigesetzt werden und zahlreiche Funktionen im Körper steuern. Diese Prozesse laufen in fein abgestimmten Regelkreisen ab, bei denen eine Störung die Funktion verschiedener Organe beeinträchtigen kann.
Unser Fokus liegt auf Hormonerkrankungen bei Frauen, insbesondere in der gynäkologischen Endokrinologie
Dabei stehen folgende Organe im Mittelpunkt:
• Eierstöcke (Ovarien)
• Hirnanhangdrüse (Hypophyse)
• Teile des Gehirns, wie den Hypothalamus
• Schilddrüse
Unsere Expert:innen sind darauf spezialisiert, die Gesundheit dieser Organe zu überwachen, hormonelle Dysbalancen zu erkennen und gezielte Behandlungen einzuleiten, um die natürlichen Steuerungsmechanismen wieder ins Gleichgewicht zu bringen.
Expertise in hormoneller Steuerung für Ihre Gesundheit
Hormone spielen eine entscheidende Rolle als Steuerungsmechanismen, insbesondere für die Funktion der Genitalorgane. Wir wissen, wie Störungen in diesen Prozessen Ihre Gesundheit beeinträchtigen können. Mit unserer Erfahrung und unserem Fachwissen stehen wir Ihnen zur Seite, um Ihre Gesundheit optimal zu unterstützen.
Beratung, Diagnostik und Behandlung im Hormonzentrum
Am Anfang steht ein ausführliches Beratungsgespräch, in dem wir gemeinsam Ihre individuellen Bedürfnisse besprechen. Eine präzise Diagnostik hilft uns dabei, die für Sie passende Behandlungsmethode zu finden.
Unser Hormonzentrum bietet Ihnen umfassende Beratung, Diagnostik und Therapie zu folgenden Themen:
- Angeborene oder vererbbare Hormonerkrankungen
- Hormonveränderungen und -störungen in Kindheit, Pubertät und Erwachsenenalter
- Hormonstörungen bei Kinderwunsch
- Hormonelle Veränderungen in Schwangerschaft und Stillzeit
- Wechseljahresbeschwerden und hormonelle Störungen im Alter
- Hormonelle Auswirkungen von Erkrankungen anderer Organe
- Endometriose
- Hormonelle Einflüsse auf die Brustdrüse
- Hormonabhängige Krebserkrankungen
- Auswirkungen von Medikamenten auf das Hormonsystem
- Verhütungsmethoden
Unser Ziel ist es, Sie bestmöglich zu unterstützen und Ihre Gesundheit wieder ins Gleichgewicht zu bringen.
Das Syndrom der polyzystischen Ovarien (PCO-Syndrom)
Das PCO-Syndrom äußert sich durch verschiedene Symptome:
- Unregelmäßiger Zyklus: Die Regelblutung tritt selten (Oligomenorrhoe) oder gar nicht auf (Amenorrhoe), was die Fruchtbarkeit beeinträchtigen kann.
- Anzeichen erhöhter männlicher Hormone (Hyperandrogenämie): Dies zeigt sich durch Akne, fettige Haut, Haarausfall oder vermehrte Körperbehaarung, insbesondere im Gesicht und Bauchbereich.
- Typisches Ultraschallbild: Die Eierstöcke erscheinen vergrößert, mit einem Kranz größerer Eibläschen und einem dichten Gewebe im Inneren.
- Begleitende Stoffwechselerkrankungen: Häufig treten Bluthochdruck oder Diabetes auf.
Ursachen
Die genauen Ursachen des PCO-Syndroms sind noch unklar. Es wird jedoch angenommen, dass fehlende Eisprünge und die daraus resultierende Hormonveränderung eine Rolle spielen. Übergewicht, Diabetes oder ein Überschuss an männlichen Hormonen, beispielsweise durch angeborene Hormonerkrankungen, können die Entstehung zusätzlich begünstigen.
Behandlungsmöglichkeiten
Das PCO-Syndrom tritt nicht nur bei übergewichtigen Frauen auf, doch bei Betroffenen mit Übergewicht ist eine Gewichtsreduktion essenziell. Eine Kombination aus Ernährungsumstellung und Sport kann den Kreislauf aus erhöhten männlichen Hormonen, Insulinresistenz und Übergewicht durchbrechen.
- Kein Kinderwunsch: Die Einnahme einer geeigneten Antibabypille kann den Zyklus regulieren und die Wirkung männlichen Hormone unterdrücken. Spezielle Präparate helfen deshalb auch gegen Beschwerden wie Akne, Haarausfall oder Mehrbehaarung.
- Bei Kinderwunsch: Zur Unterstützung der Eizellreifung und des Eisprungs werden häufig Tabletten oder Hormonspritzen eingesetzt, die das follikelstimulierende Hormon (FSH) enthalten oder dessen Produktion fördern.
- Insulinresistenz: Falls eine Insulinresistenz nachgewiesen wird, kann Metformin, ein Diabetes-Medikament, helfen, den Zuckerstoffwechsel zu regulieren und die Hormone ins Gleichgewicht zu bringen.
Spezielle medikamentöse Therapie: In einigen Fällen, insbesondere bei Funktionsstörungen der Nebennierenrinde, kann ein niedrig dosiertes Glukokortikoid wie Dexamethason eingesetzt werden, um die Produktion männlicher Hormone in der Nebenniere zu reduzieren. Dies ist jedoch nicht geeignet bei Insulinresistenz, Diabetes oder starkem Übergewicht, da es die Symptome verschlechtern könnte.
Hyperprolaktinämie: Ein häufiges Hormonproblem
Die Hyperprolaktinämie, ein Überschuss des Hormons Prolaktin im Blut, kann Zyklusstörungen verursachen und die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Prolaktin wird im Vorderlappen der Hirnanhangsdrüse produziert und spielt besonders während der Stillzeit eine wichtige Rolle bei der Milchbildung.
Was erhöht den Prolaktinspiegel?
Verschiedene Faktoren können den Prolaktinspiegel ansteigen lassen:
- Medikamente: Dazu zählen u. a. Antidepressiva, blutdrucksenkende Präparate, Neuroleptika, Hormone und einige Schmerzmittel.
- Stress: Physischer oder emotionaler Stress kann den Wert ebenfalls erhöhen.
- Körperliche Reize: Untersuchungen der Brust oder gynäkologische Vorsorgeuntersuchungen.
- Erkrankungen: Vergrößerungen der Hirnanhangsdrüse (Prolaktinome), Störungen des Zentralnervensystems, Schilddrüsenunterfunktion, Stoffwechselerkrankungen wie Morbus Cushing oder Akromegalie.
- Schwangerschaft und Stillzeit
Mögliche Folgen der Hyperprolaktinämie
- Milchfluss aus den Brustdrüsen (Galaktorrhoe)
- Ausbleibende oder unregelmäßige Regelblutungen (Amenorrhoe/Oligomenorrhoe)
- Beeinträchtigte Eizellreifung und Ovulation, was zu ungewollter Kinderlosigkeit führen kann
- Erhöhte Spiegel männlicher Hormone (Hyperandrogenämie)
- Verminderte Knochendichte durch Östrogenmangel
Diagnostik
Je nach Symptomen können folgende Untersuchungen durchgeführt werden:
- Bluttests zur Bestimmung von Prolaktin und anderen Hormonwerten (z. B. Schilddrüsenhormone)
- Magnetresonanztomographie (MRT) zur Abklärung von Tumoren in der Hirnanhangsdrüse
- Untersuchung des Blickfeldes, um mögliche Einschränkungen durch ein Prolaktinom zu erkennen
- Brustuntersuchungen und bei Sehstörungen augenärztliche Abklärung
Therapiemöglichkeiten
- Medikamentöse Behandlung: Dopaminagonisten wie Cabergolin oder Bromocriptin reduzieren den Prolaktinspiegel und lindern Beschwerden. Sie werden meist abends eingenommen, um Nebenwirkungen wie Übelkeit zu minimieren.
- Operative Eingriffe: Diese sind selten und nur bei großen, therapieresistenten Prolaktinomen oder bei Kompression von Nachbarorganen notwendig.
- Keine Behandlung erforderlich: Liegt kein Kinderwunsch vor und treten keine Beschwerden auf, ist oft keine Therapie nötig.
- Besonderheiten bei Schwangerschaft und Stillzeit
- Während der Schwangerschaft wird die medikamentöse Therapie bei kleinen Prolaktinomen oft abgesetzt. Bei größeren Tumoren erfolgt dies in Absprache mit einem Hormonzentrum.
- Stillen ist bei Hyperprolaktinämie unbedenklich, da die Hirnanhangsdrüse dadurch nicht weiter vergrößert wird.
Verhütung
Eine hormonelle Verhütung (Pille, Vaginalring, Hormonspirale) ist möglich. Dabei sollte bei Prolaktinomen der Östrogenanteil so niedrig wie möglich sein.
Vorzeitige Wechseljahre (Climacterium praecox)
Die vorzeitigen Wechseljahre beschreiben das Ende der Eierstockfunktion vor dem 40. Lebensjahr. Normalerweise erschöpft sich die Eizellreserve allmählich, wobei die Menopause im Durchschnitt um das 52. Lebensjahr eintritt. Anzeichen wie Hitzewallungen, Stimmungsschwankungen, Zyklusstörungen oder trockene Schleimhäute können jedoch schon deutlich früher auftreten.
Anzeichen der vorzeitigen Wechseljahre
- Seltener werdende oder ausbleibende Regelblutungen
- Typische Wechseljahrsbeschwerden wie Hitzewallungen, Stimmungsschwankungen oder trockene Schleimhäute
Mögliche Ursachen
- Idiopathisch: Häufig lässt sich keine Ursache feststellen.
- Autoimmunerkrankungen: Das Immunsystem greift körpereigene Strukturen an, z. B. Eierstockgewebe. Begleitend können andere Autoimmunerkrankungen wie Hashimoto-Thyreoiditis, rheumatoide Arthritis oder Vitiligo auftreten.
- Genetische Ursachen: Erkrankungen wie Turner-Syndrom, Fragiles-X-Syndrom oder Mutationen bestimmter Gene können die Funktion der Eierstöcke beeinträchtigen.
- Umweltfaktoren: Strahlentherapie, Chemotherapie, operative Entfernung der Eierstöcke oder bestimmte Chemikalien, z. B. in Zigaretten, können die Funktion der Eierstöcke negativ beeinflussen.
- Seltene Stoffwechselstörungen: Beispielsweise Galaktosämie oder Enzymdefekte.
Diagnostik
Um die vorzeitigen Wechseljahre zu diagnostizieren, können folgende Untersuchungen durchgeführt werden:
- Hormonanalysen (z. B. FSH, LH, Östradiol, Anti-Müller-Hormon)
- Genetische Tests bei Verdacht auf Chromosomenanomalien
- Abklärung von Autoimmunerkrankungen
- Bildgebende Verfahren wie Ultraschall oder Magnetresonanztomographie (MRT), falls notwendig
Therapieoptionen
- Vorübergehendes Phänomen: Bei intermittierendem Versagen der Eierstöcke kann eine Hormonersatztherapie die Funktion zeitweise reaktivieren. Eine Schwangerschaft ist in solchen Fällen möglich.
- Dauerhafter Verlust der Eierstockfunktion: Eine langfristige Hormonersatztherapie ist essenziell, um das Risiko für Osteoporose und andere Hormonmangelerkrankungen zu reduzieren.
- Kinderwunsch:
-
- Bei Restfunktion der Eierstöcke kann eine hormonelle Stimulationstherapie durchgeführt werden, um die Eizellreifung zu fördern.
-
- Bei vollständig erloschener Funktion bleibt als Option nur eine Eizellspende. Diese ist jedoch in Deutschland gesetzlich nicht erlaubt und nur im Ausland möglich. Alternativ kommen Adoptionen infrage.
Experimentelle Ansätze
Neue Methoden wie die Injektion von Plättchen-reichem Plasma (PRP) in die Eierstöcke oder die Anwendung von Wachstumshormonen werden derzeit erforscht, gelten jedoch noch als experimentell.
Turner-Syndrom: Ursachen, Symptome und Behandlung
Das Turner-Syndrom entsteht durch das Fehlen oder die Veränderung eines X-Chromosoms. Es führt zu charakteristischen körperlichen und hormonellen Veränderungen.
Häufige Merkmale des Turner-Syndroms
- Kleinwuchs: Ursache ist ein Mangel des SHOX-Gens.
- Äußerliche Auffälligkeiten: Dazu zählen Flügelfell (Hautfalte am Hals), Muttermale (Naevi), breiter Brustkorb (Schildthorax) und andere anatomische Besonderheiten.
- Fehlende Eierstockfunktion: Durch frühzeitige Degeneration der Eizellreserven entwickeln sich funktionslose Stranggonaden. Eine natürliche Pubertät bleibt aus, und eine Schwangerschaft ist ohne medizinische Hilfe nicht möglich.
- Weitere Funktionsstörungen: Diese betreffen häufig das Herz-Kreislauf-System, den Zucker- und Fettstoffwechsel sowie die Schilddrüse.
- Heterogenes Erscheinungsbild: Bei Mosaiken, bei denen nicht alle Zellen betroffen sind, können die Symptome milder ausfallen.
Diagnostik und Untersuchungen
- Chromosomenanalyse: Die Diagnose erfolgt durch die Analyse von Blutzellen oder Hautzellen.
- Erweiterte Tests: Untersuchungen klären, ob ein Mosaik oder ein teilweiser Verlust des X-Chromosoms vorliegt, ob Y-Chromosomenanteile vorhanden sind oder ob eine Restfunktion der Eierstöcke besteht.
- Zusätzliche Untersuchungen: Dazu gehören Ultraschalluntersuchungen von Herz und Nieren sowie ein Hörtest.
Wachstum und Pubertät
- Wachstum: Mithilfe von Wachstumshormonen kann die Körpergröße gesteigert werden. Ziel ist es, eine normale Größe zu erreichen, die dem Alter entspricht, um die soziale Entwicklung zu fördern.
- Pubertätsinduktion: In der Regel beginnt die Therapie mit Östrogenen ab einem Alter von 12 Jahren, um eine körperliche Entwicklung und die Gebärmutterreifung zu fördern. Ab dem dritten Jahr wird ein Gelbkörperhormon ergänzt, um eine regelmäßige Periode sicherzustellen.
Fruchtbarkeit und Schwangerschaft
- Bei funktionierenden Eierstöcken: In seltenen Fällen ist eine spontane Schwangerschaft möglich. Häufig sind jedoch hormonelle Stimulationen notwendig, da die Fruchtbarkeit durch vorzeitige Wechseljahre eingeschränkt ist.
- Ohne Eierstockfunktion: Schwangerschaften sind nur durch Embryotransfer nach einer Eizellspende möglich. Diese Option ist in Deutschland gesetzlich (noch) nicht erlaubt, jedoch in anderen Ländern zugänglich. Alternativ bleibt eine Adoption.
- Schwangerschaftsrisiken: Vor einer Schwangerschaft ist eine umfassende internistische Abklärung notwendig, da Risiken wie Gestationsdiabetes, Bluthochdruck und Herz-Kreislauf-Komplikationen erhöht sind.
Folgeerkrankungen und Prävention
Frauen mit Turner-Syndrom sollten regelmäßig auf mögliche Begleiterkrankungen untersucht werden, darunter:
- Herz-Kreislauf- und Nierenerkrankungen
- Autoimmunerkrankungen der Schilddrüse
- Diabetes und Fettstoffwechselstörungen
- Osteoporose
Hormonersatztherapie
- Östrogene in Kombination mit Gelbkörperhormonen sind essenziell, um Osteoporose, Schleimhautprobleme und Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorzubeugen.
- Ergänzend sollten Vitamin D und Calcium eingenommen werden.
Fertilitätserhalt bei funktionierenden Eierstöcken
Zur Sicherung der Fruchtbarkeit können unbefruchtete Eizellen oder Eierstockgewebe eingefroren werden. Bei bestehendem Partner können auch befruchtete Eizellen kryokonserviert werden. Diese Maßnahmen sind besonders wichtig, da oft vorzeitige Wechseljahre eintreten.

